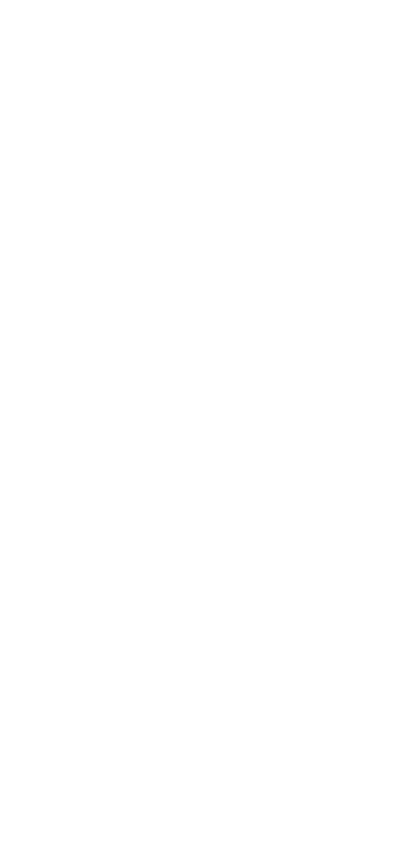Fledermäuse haben keinen guten Ruf. Viele Menschen denken bei ihnen an Vampirgeschichten, nächtliche Angriffe oder gruselige Schatten in dunklen Höhlen. Doch die meisten Fledermäuse sind alles andere als furchteinflössend – und einige tragen sogar zur Erhaltung des Regenwaldes bei, indem sie als Samenverbreiter fungieren. Eine dieser Arten stellen wir hier vor: Die Brillenblattnase. Sie hat so manche überraschende Eigenschaft, die man ihr auf den ersten Blick nicht ansieht.
Zuhause im tropischen Amerika
Die Brillenblattnase ist eine echte Überlebenskünstlerin – und weit verbreitet: Sie kommt vom südlichen Mexiko bis nach Brasilien, Paraguay und Bolivien vor. Auch auf Inseln wie Trinidad oder Tobago ist sie zu finden. In vielen Regenwaldregionen Südamerikas zählt sie zu den am häufigsten gefangenen und erforschten Fledermäusen überhaupt (1).
Ihr Zuhause sind feuchte tropische Wälder, vor allem solche mit dichtem Unterwuchs. Dort schläft sie tagsüber in Baumhöhlen, Felsspalten oder verlassenen Gebäuden und verlässt ihre Verstecke erst nach Sonnenuntergang. Besonders wohl fühlt sie sich in Gebieten mit viel Vegetation und hoher Luftfeuchtigkeit, manchmal sogar in regenerierten Sekundärwäldern (1).
Auf Nahrungssuche: Was die Brillenblattnase frisst
Wer sie beobachten will, muss früh aufstehen oder besser noch: lange wach bleiben. Denn erst nach Einbruch der Dunkelheit beginnt für die Brillenblattnase die Suche nach Nahrung. Mit Hilfe von Echoortung orientiert sie sich im dichten Unterwuchs des Regenwalds – gezielt und erstaunlich präzise. Besonders häufig frisst sie Früchte aus der Pflanzengattung Piper. Diese Pflanzen liefern viel Energie und sind in vielen tropischen Regionen fast das ganze Jahr über verfügbar (2).
Trotz dieser klaren Vorliebe ist die Brillenblattnase nicht wählerisch: Sie frisst eine Vielzahl unterschiedlicher Früchte, ergänzt durch Blüten, Nektar und gelegentlich auch kleine Insekten. Gerade in der Trockenzeit, wenn Piper-Früchte knapp sind, weicht sie flexibel auf andere Pflanzenarten aus (2).
Ihre Verdauung läuft dabei besonders schnell ab – schon etwa 20 Minuten nach dem Fressen scheidet sie die ersten Samen wieder aus. (2).

Brillenblattnase mit einer reifen Piper-Frucht (© Merlin Tuttle).
Eine stille Gärtnerin des Regenwalds
Damit spielt die Brillenblattnase eine Schlüsselrolle im tropischen Ökosystem: Indem sie die Samen vieler Pflanzenarten verbreitet – besonders die von Piper – trägt sie zur Artenvielfalt des Regenwalds bei. Weil sie oft in der Nähe ihrer Schlafplätze frisst und die Samen dort ausscheidet, entstehen regelrechte Hotspots der Pflanzendiversität. Diese Vielfalt wirkt sich stabilisierend aus: Wo viele verschiedene Pflanzen nebeneinander wachsen, wird der Befall durch spezialisierte Insekten messbar reduziert (3).
Solche Orte können auch Keimzellen neuer Wälder sein. Die Brillenblattnase trägt durch die Verbreitung von Samen zur natürlichen Regeneration degradierter Lebensräume bei (4).
Soziale Gruppen mit Dynamik
Brillenblattnasen leben nicht allein. Tagsüber ruhen sie in Gruppen in Höhlen oder Baumhöhlen – häufig in sogenannten Harems, die aus einem Männchen und mehreren Weibchen bestehen. Dieses dominante Männchen verteidigt den Ruheplatz energisch gegen Rivalen. Doch auch Gruppen mit mehreren Männchen oder rein männliche Zusammenschlüsse kommen vor. Die Gruppenzusammensetzung kann sich schnell verändern: Weibchen wechseln oft den Harem, während junge Männchen darauf hoffen, eines Tages selbst eine Gruppe zu übernehmen (5).
Eine kleine Gruppe von Brillenblattnasen (© Pablo Barrera).
Timing ist alles
Die Weibchen der Brillenblattnase zeigen ein bemerkenswertes Timing. Viele bringen ihre Jungen in der Regenzeit zur Welt – genau dann, wenn der Wald besonders viele Früchte trägt. So sichern sie die Versorgung während der energieintensiven Phase des Säugens. Spannend ist: Nicht alle Weibchen eines Harems sind gleichzeitig trächtig. Diese zeitliche Streuung könnte dabei helfen, die Aufzucht besser zu koordinieren oder das Risiko von Nahrungsmangelphasen für die Jungtiere zu senken (5).
Fledermäuse zwischen Vorurteil und Lebensraumverlust
Auch wenn die Brillenblattnase vielerorts noch häufig ist, bleibt ihr Schutz wichtig – nicht wegen akuter Bedrohung, sondern weil sie in einem Ökosystem lebt, das unter Druck steht. Entwaldung, Urbanisierung und der Verlust alter Bäume schränken mögliche Quartiere und Nahrungsquellen ein. Hinzu kommen Vorurteile, die Fledermäuse pauschal mit Krankheit oder Gefahr in Verbindung bringen – auch wenn viele, wie die Brillenblattnase, völlig ungefährlich sind und dem Wald wichtige Dienste leisten.
Massnahmen wie künstliche Fledermausquartiere, Umweltbildung und die Einbindung der lokalen Bevölkerung helfen nicht nur einzelnen Arten, sondern tragen zum Erhalt ganzer Ökosysteme bei (6).
Autor: Robert Delilkhan, Praktikant
Literaturverzeichnis
(1) Cloutier, D., & Thomas, D. W. (1992). Carollia perspicillata. Mammalian Species, (417), 1–9. https://doi.org/10.2307/3504147
(2) Mello, M. A. R., Schittini, G. M., Selig, P., & Bergallo, H. G. (2004). Seasonal variation in the diet of the bat Carollia perspicillata (Chiroptera: Phyllostomidae) in an Atlantic Forest area in southeastern Brazil. Mammalia, 68(1), 49–55. DOI:10.1515/mamm.2004.006
(3) Salazar, D., Kelm, D. H., & Marquis, R. J. (2013). Directed seed dispersal of Piper by Carollia perspicillata and its effect on understory plant diversity and folivory. Ecology, 94(11), 2444–2453. https://doi.org/10.1890/12-1172.1
4) Parolin, L. C., Lacher, T. E., Bianconi, G. V., & Mikich, S. B. (2021). Frugivorous bats as facilitators of natural regeneration in degraded habitats: A potential global tool. Acta Oecologica, 111, 103748. https://doi.org/10.1016/j.actao.2021.103748
(5) Martínez-Medina, D., Pérez-Torres, J., & Martínez-Luque, L. (2022). Apuntes sobre la estructura social de Carollia perspicillata (Chiroptera, Phyllostomidae) en la cueva Macaregua, Santander, Colombia. Mastozoología Neotropical, 29(1), 180–191. https://doi.org/10.31687/saremMN.22.29.1.0.08
(6) Vieda-Ortega, J. C., Muñoz-Saba, Y. D. S., Giraud-López, M. J., Aguirre-Ceballos, J., & Chaux-Rojas, D. F. (2022). Uso de refugios artificiales como estrategia para la conservación de murciélagos. Boletín Científico. Centro de Museos. Museo de Historia Natural, 26(2), 170–185. https://doi.org/10.17151/bccm.2022.26.2.11