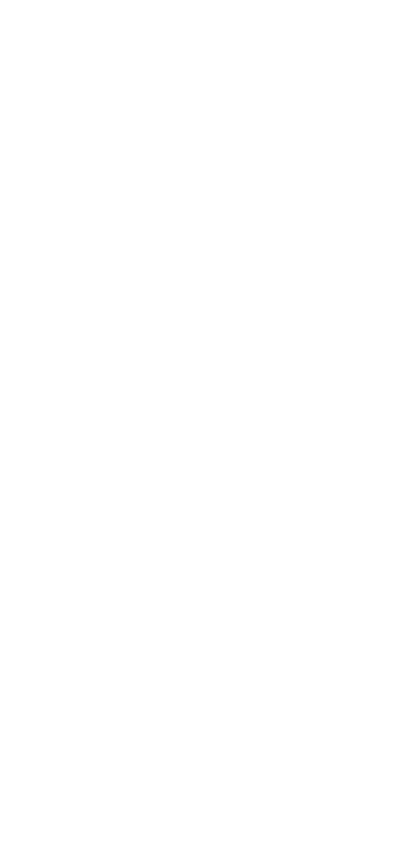Jerylee Wilkes-Allemann, Professorin für Wald- und Umweltpolitik an der Berner Fachhochschule, verbindet wissenschaftliche Expertise mit einer persönlichen Verbundenheit zu Waldlandschaften. Ihr Weg führte sie von den Wäldern Boliviens, wo sie familiäre Wurzeln hat, bis in die strategischen Debatten um urbane Grünräume in der Schweiz. Im Gespräch mit GREEN BOOTS berichtet sie über die Chancen und Grenzen der Schweizer Waldpolitik und ihre Vision nachhaltiger BioCities.
Bevor wir inhaltlich einsteigen, könnten Sie sich kurz vorstellen? Was hat Sie persönlich dazu bewegt, sich mit Fragen der Wald-, Umwelt- oder Stadtentwicklung zu beschäftigen?
Ich bin Jerylee Wilkes-Allemann, habe Waldwissenschaften in Deutschland studiert und stamme ursprünglich aus Bolivien. Dort besitzen meine Eltern ein Stück Land mit rund 600 Hektar Wald, den ich gerne erhalten und schützen möchte. Mein Vater war Agrofoorstexperte im Kakaoanbau, und durch ihn bin ich früh mit Fragen des Naturschutzes in Berührung gekommen.
Im Laufe meiner Karriere habe ich mich zunehmend auf die Schnittstellen zwischen natürlichen Ressourcen und Gesellschaft spezialisiert – besonders auf Waldpolitik und Governance. Meine Dissertation an der ETH Zürich habe ich zur Governance der Walderholung geschrieben, und so bin ich letztlich im Bereich Urban Forestry gelandet. Ich bin überzeugt: Die Natur braucht eine Stimme – und ich versuche, ihr diese Stimme zu geben.
Sie waren an der Analyse der Schweizer Waldpolitik 2020 beteiligt. Wie schätzen Sie die aktuellen Entwicklungen in diesem Feld ein?
Zurzeit entsteht eine integrale Wald- und Holzstrategie 2050, in der die Waldpolitik 2020 und die Ressourcenpolitik Holz zusammengeführt werden. Das ist grundsätzlich ein guter Ansatz. Allerdings liegt der Fokus nach wie vor stark auf der ökonomischen Nutzung, während gesellschaftliche Aspekte – etwa die Erholungsfunktion des Waldes, das Naturerlebnis Wald oder Bildung – aus meiner Sicht zu wenig berücksichtigt werden. Gerade stadtnahen Wäldern kommt eine wachsende Bedeutung zu, sei es für Bewegung, mentale Gesundheit oder das Naturerlebnis.
Themen wie Urban Forestry, also der Umgang mit Stadtbäumen, Alleen oder Parks, werden zwar erwähnt, bleiben aber am Rande. Dabei braucht es klarere Verbindungen zwischen Wald- und Stadtplanung, um die zunehmende Nutzung, den Schutz der Biodiversität und klimatische Herausforderungen in Einklang zu bringen.
Welche weiteren Entwicklungen beobachten Sie?
Es gibt mehrere politische Vorstösse, zum Beispiel zur Flexibilisierung des Rodungsersatzes oder zur Anpassung des Waldbaus an den Klimawandel. Gerade bei letzterem braucht es nicht nur mehr finanzielle Mittel, sondern auch neue Anreizsysteme und Monitoring-Instrumente – etwa um Privatwaldeigentümer zu motivieren, aktiv zu handeln. Wichtig ist auch die Rolle der Kantone: Der Bund kann Strategien vorgeben, aber die Umsetzung passiert auf kantonaler Ebene. Hier braucht es eine stärkere Koordination.
Ein weiterer kritischer Punkt ist das geplante Entlastungspaket 2027: Es sieht Kürzungen in der Bildung und bei den Programmvereinbarungen vor, unter anderem im Bereich Schutzwald. Das könnte langfristig Auswirkungen auf den Zustand unserer Wälder haben. Grundsätzlich halte ich die Schweizer Waldpolitik für gut aufgestellt – sie bleibt ihrer Multifunktionalität treu und erkennt auch die Bedeutung von Biodiversität und Klimaanpassung. Doch in einigen Punkten besteht Handlungsbedarf, gerade wenn es um die Finanzierung und klare Zuständigkeiten geht.
Ihre Forschung zeigt, dass der Bund dort am wirksamsten ist, wo er über regulatorische oder finanzielle Mittel verfügt. Wo sehen Sie konkreten Handlungsbedarf, um seine Steuerungsfähigkeit zu stärken – ohne den Föderalismus zu untergraben?
Grundsätzlich greift der Bund dort ein, wo die Kantone keine eigenständige Lösung finden können. Ein Beispiel ist die Anpassung an den Klimawandel: Hier stellt sich die Frage, ob die Kantone das allein stemmen können oder ob es zusätzliche Unterstützung vom Bund braucht – etwa in Form zweckgebundener Finanzhilfen, zum Beispiel für besonders gefährdete Waldgebiete oder Privatwaldbesitzende.
Auf Grund des Klimawandels nehmen extreme Wetterereignisse zu. Aktuell wird mit Sturm- oder Käferschäden meist kantonal und situativ umgegangen. Vielleicht wäre ein nationaler Krisenplan Wald sinnvoll – mit klaren Abläufen für Notfällungen, Soforthilfen oder abgestimmte Massnahmen. Das sind Diskussionspunkte, bei denen der Bund künftig eine stärkere koordinierende Rolle einnehmen könnte.

Wilkes-Allemann bei der Diskussion von waldbaulichen Massnahmen zur Erholung. © A. Bernasconi
Wenn man die Schweizer Erfahrungen mit partizipativer Waldpolitik betrachtet: Gibt es aus Ihrer Sicht Aspekte, die auch für Länder mit tropischen Wäldern, etwa Indonesien, als Vorbild dienen könnten?
Ja, ich denke insbesondere der Grundsatz der Multifunktionalität und der nachhaltigen Waldbewirtschaftung sind zentrale Elemente, die auch international anschlussfähig sind. Ebenso die Bedeutung von guter Governance. Die Schweiz hat in diesen Bereichen wichtige Erfahrungen gemacht, von denen andere Länder profitieren könnten.
Historisch betrachtet stand die Schweiz im 19. Jahrhundert selbst kurz vor der Entwaldung. Nur noch rund fünf Prozent der bewaldeten Fläche war erhalten. Durch ein starkes Waldgesetz und gezielte politische Massnahmen gelang es, die Waldflächen wiederaufzubauen. Heute steht der Wald auf einer stabilen Grundlage, und das Land verfolgt einen integrativen Ansatz, der ökologische, soziale und wirtschaftliche Interessen miteinander verbindet.
Länder wie Indonesien oder Bolivien befinden sich derzeit in einer anderen Phase. Sie stehen unter starkem wirtschaftlichem Entwicklungsdruck, was oft zu einem intensiven Ressourcenverbrauch führt. Gleichzeitig werden die Folgen der Entwaldung – etwa zunehmende Trockenheit oder Bodenerosion – bereits spürbar. Hier kann die Schweiz durch ihre Geschichte und ihre heutigen Ansätze eine Brückenrolle übernehmen und zeigen, dass eine nachhaltigere Entwicklung möglich ist, auch wenn die Ausgangslagen unterschiedlich sind.
Welche Rolle kann oder sollte die Schweiz heute im internationalen Tropenwaldschutz einnehmen? Und wo sehen Sie noch Lücken, etwa beim Holzhandel oder in der Gesetzgebung?
Die Schweiz engagiert sich bereits seit den 1970er-Jahren stark in internationalen Programmen und Initiativen zur Walderhaltung und zur Bekämpfung der Entwaldung. Drei Bundesstellen spielen dabei eine zentrale Rolle: das BAFU, das für Wald-, Klima- und Biodiversitätspolitik zuständig ist, die DEZA im Bereich der Entwicklungszusammenarbeit sowie das SECO, das für wirtschaftliche Zusammenarbeit und die Umsetzung handelspolitischer Massnahmen zuständig ist.
Die Schweiz hat eine Vielzahl globaler Übereinkommen unterzeichnet und beteiligt sich aktiv an multilateralen Prozessen, etwa im Rahmen der Klimapolitik oder mit Programmen wie der Forest Carbon Partnership Facility oder dem Green Climate Fund. Auch die Unterzeichnung der Glasgow Leaders Declaration und der Beitrag zu internationalen Klimakonferenzen wie der COP 27 zeigen ihr Engagement.
Ein wichtiger Schritt war zudem die Einführung der Schweizer Holzhandelsverordnung im Jahr 2022. Mit der neuen EU-Verordnung gegen Entwaldung (EUDR) eröffnen sich nun neue Perspektiven für eine vertiefte internationale Zusammenarbeit. Begleitmassnahmen, etwa Partnerschaften oder Pilotprojekte, könnten dabei eine zentrale Rolle spielen.
Die Schweiz versteht sich traditionell als Brückenbauerin. Sie bringt langjährige Erfahrung mit und ist in internationalen Verhandlungsprozessen oft moderierend tätig. Dennoch bleibt der Erfolg solcher Massnahmen abhängig von den lokalen Gegebenheiten. In vielen Regionen leben Menschen direkt vom Wald – das muss bei allen Projekten und politischen Strategien mitbedacht werden.
Gibt es etwas, das Sie an der internationalen Politik der Schweiz im Bereich Waldschutz kritisieren würden?
Grundsätzlich sehe ich die Schweiz auf einem guten Weg. Persönlich habe ich durch meinen Vater, der jahrzehntelang in der Entwicklungszusammenarbeit tätig war, miterlebt, wie komplex diese Prozesse sind. Projekte in tropischen Ländern brauchen Zeit und lokale Unterstützung. Es reicht nicht, einfach eine gute Idee aus Europa zu übertragen – man braucht Menschen vor Ort, die überzeugt sind und den Wandel mittragen.
Vielleicht wäre es ein nächster Schritt, dass die Schweiz – basierend auf ihrer langjährigen Erfahrung – eine eigene internationale Waldstrategie entwickelt. Das könnte helfen, das vielfältige Engagement klarer zu bündeln. Die politische Neutralität der Schweiz wird international geschätzt und könnte helfen, solche Prozesse noch wirkungsvoller zu gestalten.
Die EU hat kürzlich mit der EUDR eine neue Regulierung verabschiedet, die Unternehmen zu entwaldungsfreien Lieferketten verpflichtet. Wie bewerten Sie diese Verordnung – und sollte die Schweiz ein ähnliches Gesetz einführen?
Die EUDR ist aus meiner Sicht ein bedeutender Meilenstein für den globalen Waldschutz. Sie ist rechtlich verbindlich und verlangt, dass nur noch entwaldungsfreie Produkte auf den europäischen Markt gelangen dürfen. Damit geht sie über frühere Regelungen hinaus, die sich vor allem auf illegalen Holzschlag konzentrierten. Nun wird auch legale, aber ökologisch problematische Entwaldung adressiert.
In der Umsetzung sehe ich jedoch grosse Herausforderungen. Die Verordnung erfordert ein umfassendes Monitoring und eine wirksame Kontrolle – beides ist mit erheblichem Aufwand verbunden. Es stellt sich die Frage, ob das zeitlich und strukturell überhaupt machbar ist.
Was die Schweiz betrifft, so wäre es sinnvoll, sich an der EUDR zu orientieren. Eine direkte Übernahme wäre aber nur sinnvoll, wenn sie auch praktisch umsetzbar ist. Der politische Wille fehlt derzeit. Auch die starke Lobby der Landwirtschaft könnte hier eine Rolle spielen. Ob es ein eigenes Entwaldungsgesetz braucht, ist derzeit offen.
Die Idee der EUDR ist ja auch, Zwischenhändler zu reduzieren und die Lieferketten transparenter zu machen. Aber das bestehende System ist stark und gut eingespielt. Es bleibt abzuwarten, ob die EUDR tatsächlich den erhofften Wandel bringt – und ob andere Länder darauf reagieren. Wenn Europa nur noch zertifizierte Produkte zulässt, könnte das indirekten Druck auf andere Märkte erzeugen.
Die EUDR wird nicht nur positiv aufgenommen. Kritiker befürchten eine Benachteiligung kleiner Produzentinnen und Produzenten. Wie schätzen Sie diese Debatte ein?
Die Bedenken sind berechtigt. Gerade kleine Betriebe verfügen oft nicht über die finanziellen oder technischen Mittel, um die neuen Anforderungen umfassend umzusetzen. Grosse Unternehmen sind besser aufgestellt und haben weniger Risiko, vom Markt ausgeschlossen zu werden.
Deshalb braucht es gezielte begleitende Massnahmen, etwa in Form von vereinfachten Verfahren, finanzieller Unterstützung oder Schulungsangeboten. Die Umsetzung muss flexibel und differenziert erfolgen – es gibt keine Lösung, die überall gleich gut passt. Jedes Land, jede Produktionsstruktur funktioniert anders.
Wenn wir zum Schluss noch etwas übergeordneter auf globale Umweltgovernance blicken: Welche Ansätze halten Sie für besonders wirksam und gerecht, um internationale Umweltprobleme wie die Entwaldung anzugehen?
Ich halte kooperative Handelsabkommen und Partnerschaften für zentral. Die Schweiz engagiert sich bereits aktiv in solchen Formaten, und das ist ein wichtiger Hebel. Auch positive Marktanreize sind entscheidend – etwa durch vereinfachten Marktzugang für nachhaltig zertifizierte Produkte oder durch gezielte Fördermechanismen wie REDD+.
Ein weiteres zentrales Thema ist die Stärkung lokaler Landrechte. Viele indigene oder lokale Gemeinschaften besitzen das Land, das sie bewirtschaften, oft nicht offiziell. Das führt zu Unsicherheit und zur Übernutzung der Ressourcen. Wer den Wald schützen soll, muss auch die Kontrolle darüber haben.
Letztlich braucht es mehr internationalen Dialog. Die Entwaldung ist ein globales Problem, doch Wälder liegen in nationaler Verantwortung. Der Amazonas betrifft uns alle, aber mit dem Finger auf andere Länder zu zeigen, führt nicht weiter. Wir müssen Menschen motivieren, den Wald zu erhalten – und ihnen zugleich Alternativen zur wirtschaftlichen Nutzung bieten. Länder wie Bolivien wollen sich entwickeln. Wenn sie das durch Entwaldung tun, wie etwa mit der Viehexportproduktion nach China, stellt sich die Frage: Wo liegt die Verantwortung – beim Produzentenland oder beim Abnehmer?
Diese Fragen zeigen, wie komplex das Thema ist. Es braucht Dialog, Anreize und langfristige Partnerschaften, damit ein echter Wandel möglich wird. Aber das ist ein langer Prozess.
Sie haben gemeinsam mit Kolleginnen und Kollegen am Konzept der BioCity gearbeitet. Was genau verstehen Sie unter einer BioCity?
Für mich repräsentieren Biocities die Städte der Zukunft, in denen die grünen Ressourcen als zentrale Elemente der Stadtplanung fungieren. Sie zeichnen sich durch eine ganzheitliche Planung und Gestaltung aus, die mehrere Ebenen – beispielsweise Architektur, Technik, Ökologie und Soziales - integrieren.
In Ihrem Beitrag zeigen Sie, dass der Übergang zu BioCities von vielen Faktoren abhängt – etwa politischer Stabilität, wirtschaftlicher Volatilität oder technologischer Entwicklung. Was sind aus Ihrer Sicht aktuell die grössten Herausforderungen für die konkrete Umsetzung dieses Ansatzes in europäischen Städten?
Die aktuelle Herausforderung ist das vorherrschende Silo-Denken. Derzeit sind wir noch weit davon entfernt, holistisch zu planen und über unseren Tellerrand hinauszudenken. Wir müssen viel in Kommunikation investieren, eine gemeinsame Sprache finden und an einem gemeinsamen Ziel arbeiten: nachhaltige, resiliente und gesunde Städte zu erarbeiten.
Das Konzept der BioCity wurde für europäische Städte entwickelt, doch weltweit – etwa in Indonesien mit der neuen Hauptstadt Nusantara – entstehen derzeit neue urbane Räume. Sehen Sie Potenzial, den BioCities-Ansatz auch auf solche Entwicklungen in tropischen Regionen zu übertragen? Was müsste dabei angepasst werden?
Natürlich ist das ein Konzept, das überall übertragen werden kann. Ich nahm dieses Jahr am African Forum on Urban Forestry teil und konnte dort bestätigen, dass alle Städte ähnlichen Herausforderungen gegenüberstehen, jedoch variiert die Intensität dieser Herausforderungen und es gibt einige Themen, die in manchen Ländern präsenter sind, z. B. Gender und Gerechtigkeit. Grundsätzlich kann das Konzept aber überall angewandt werden. Es geht darum, Bäume als Kernelement der Planung zu integrieren und sie nicht zuerst zu entfernen und erst dann als Schmuckelement zu berücksichtigen. Damit dies der Fall ist, braucht es eine partizipative Planung, in der die Gesellschaft eine wichtige Rolle spielt, sowie eine holistische Planung, in die unterschiedliche Disziplinen integriert werden. Wir brauchen ein Umdenken in der Stadtplanung und -entwicklung. Dies braucht Zeit, Geduld, Mitwirkung der Gesellschaft und soziale Innovationen.
Zum Schluss würde mich noch interessieren: Konnten Sie inzwischen konkrete Schritte unternehmen, um den Wald ihrer Familie zu schützen?
Seit zwei Jahren versuche ich mit verschiedenen Organisationen in Kontakt zu treten. Zuerst wollte ich den Schutz privat organisieren, habe aber schnell gemerkt, dass das finanziell nicht tragbar ist. Zur Zeit prüfe ich, ob ich eine Stiftung gründen kann, um Fördergelder zu erhalten.
In dieser Region der gesellschaftliche Druck ist hoch. Vor eineinhalb Jahren wurden uns zwanzig Bäume gestohlen. Die Entwaldung rundherum nimmt zu, die Stadt rückt näher. Trotzdem ist dieses Stück Land besonders: Mein Vater hat es bis zu seinem Tod 45 Jahre lang geschützt, es beherbergt viele seltene Tierarten und ist Teil des bedrohten Chaco-Walds, den es nur in Bolivien, Argentinien und Paraguay gibt. Ich hoffe natürlich, es weiterhin zu schützen und ein Ausbildungs- und Forschungszentrum für Agroforst- und Forststudierende aus aller Welt aufzubauen.

Der Gran Chaco bezeichnet eine Region in Südamerika, die sich von Bolivien über Paraguay und kleine Randgebiete Brasiliens bis in den Norden Argentiniens erstreckt. © Dr. Jerylee Wilkes-Allemann, 2025
Zur Person:
Dr. Jerylee Wilkes-Allemann ist Professorin für Wald- und Umweltpolitik an der Berner Fachhochschule (Hochschule für Agrar-, Forst und Lebensmittelwissenschaften HAFL) und leitet dort interdisziplinäre Projekte im Bereich Urban Forestry, Ökosystemleistungen mit Fokus Erholung, Wald- und Umweltpolitik. Nach ersten beruflichen Stationen am European Forest Institute und an der Albert- Ludwigs Universität Freiburg war sie unter anderem für die Forschungsanstalt für Wald, Schnee und Landschaft WSL, Agroscope und die ETH Zürich tätig. Ihre Dissertation verfasste sie an der ETH Zürich zur Governance der Walderholung – ein Thema, das sie seither wissenschaftlich und praxisnah weiterverfolgt.
Das Interview hat Robert Delilkhan, Praktikant, geführt.